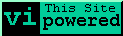Karibik – Februar 2000
Nachdem ich nach meiner Karibikreise
im Februar 2000 bald müde wurde, immer wieder „alles“ zu
erzählen, entschloss ich mich, einen ausführlichen
Bericht zu schreiben. Dies, liebe LeserInnen, ist das Ergebnis.
Ich hoffe, Du hast beim Lesen auch so viel Spaß wie ich bei
der Reise.
Wien, im März 2000
Einreisen oder nicht einreisen – das ist hier die Frage
Warten ...
Pigeon Island
Marigot's Bay
Erstes Inselspringen
Kaum von zuhause weg, wieder in Schengen ...
Nicht nur Vögel können fliegen
The Saints
Guadeloupe
Gibraltar und andere Geheimnisse des Zollwesens
Inselerkundung
Wir werden überfallen – aber nicht beraubt
Der Kanal
Von Riffen, Friedhöfen und Fischen
Antigua
Heimreise
Nach fast zwölf Stunden Flug komme ich am späten Nachmittag
des 3. Februar endlich in St. Lucia an. Mein Ansinnen, gleich am
Flughafen ein Hotel zu suchen (das Segelboot wird erst am nächsten
Tag auf der Insel sein), wird von einer Zöllnerin sogar noch
unterstützt: „Zuerst fragst Du da hinten am Informationsstand
nach einem Hotel, dann bekommst Du Deinen Pass wieder zurück.“
Doch selbst mit gefundenem Hotel bin ich ihr äußerst suspekt.
Was tut ein allein reisender, schlecht englisch sprechender
Österreicher auf dieser Insel? Ein Segelboot besteigen?
Blasphemie! Erst als Miss Einreisebehörde meinen
US-Immigration-Stempel (Atlanta, 1998) sieht, wird sie milde. Die erste
Hürde ist geschafft.
Doch gleich darauf folgt die Gepäckskontrolle. Dieters Vater hat
mir eine kleine Tasche mitgegeben, in der sich unter anderem ein
Lüfter für das Boot befand. Natürlich muss ich ebendiese
Tasche durchsuchen lassen.
„What's in this bag?“
„Something for the boat. I don't know exactly.“
Wir packen gemeinsam aus.
„Oh, a smoke detector!“
Nun ja, knapp vorbei ist auch daneben. Hätte sie die beiden
Metallteile zum Befestigen von Tauen in der Tasche auch noch entdeckt,
ich hätte sie ihr wohl als Hanteln verkaufen müssen.
Ein Taxi bringt mich in eine eher ärmere Gegend gleich auf der
anderen Seite des Flughafens. Ich beschließe, den obligaten
Anruf nach Hause auf morgen zu verschieben (ich muss ja nicht
unbedingt herzeigen, dass ich ein sauteures Satellitentelefon mit
mir herumschleppe), kaufe mir noch ein wenig zu essen und gehe
früh (Ortszeit; für meine innere Uhr ist es schon
ziemlich spät) ins Bett. BBC World berichtet über
Ausschreitungen bei Demos in Österreich; ich schlafe
trotzdem gut.
Am späten Vormittag des 4. Februar fahre ich mit einem Taxi
quer durch und über die Insel zur nördlich gelegenen Rodney
Bay Marina, wo irgendwann im Laufe des heutigen Tages das Boot
eintreffen soll. Wenn ein Tourist mit fragendem Gesicht durch die
Marina geht, Tonnen von Gepäck am Rücken trägt und
sich auch sonst nicht auskennt, dann gibt es viele gute Menschen,
die ihm helfen. Ich werde also direkt zur Verwaltung gelotst:
Die müssen es nämlich wissen, wenn das Boot schon da ist.
Ist es aber nicht.
Auf einer Bank plaudere ich mit einem älteren Ehepaar aus London.
Sind sie schon ganz weg vom Fenster, als ich ihnen von der bereits
absolvierten Reise des Bootes erzähle, bleibt ihnen der Mund dann
vollends offen stehen, als ich mit den Worten „I'll call them now!“
das Satellitentelefon zücke. Dank bewundernswerter Technik klappt
die Verbindung schon beim ersten Mal. Man werde so zwischen 19:00
und 21:00 Uhr eintreffen. Es gebe ein Lokal namens Three Amigos, wo wir
einander treffen würden.
Ich habe also noch genug Zeit; Stephen King – The Green
Mile – sorgt
dafür, dass sie rasch vergeht. An leiblichem Wohl mangelt es
dank einiger Lokale ebenfalls nicht, warm & sonnig ist's auch; ich bin
also vollstens zufrieden.
Monika und Dieter treffen um 20:30 Uhr im Three Amigos ein, wenig
später betrete ich das Boot. Bine und Paul kenne ich schon von
früher, Susanne und Klaus sind ebenfalls Gäste, die – wie
ich später erfahre – mittlerweile ihren ersten Segeltörn
hinter sich gebracht hatten.
Ganz im Norden von St. Lucia gab es früher eine Insel namens
Pigeon Island, die von den Briten als
Befestigung gegen die Franzosen verwendet wurde. Als man die Marina
in der Rodney Bay baute, hat man mit dem Aushubmaterial kurzerhand
einen besiedelten Landweg zu dieser
Insel angelegt. (Und gleichzeitig sich wohl überlegt, dass
Touristen sicher gerne Eintritt bezahlen.)
Die niedriger gelegenen Gebiete der Halbinsel sind gepflegt; zwischen den
Ruinen der Verteidigungsanlagen findet man
eine haupsächlich aus Palmen bestehende
Parklandschaft. Auf dem Weg zum Gipfel entdecken wir
Lemongrass – das Aroma von frischer Zitrone,
das aus einem abgeknickten Halm ausströmt, ist einfach umwerfend.
Ebenso wie das Panorama: Im Süden und Osten
sieht man die Insel mit der großen Hafenanlage, im
Westen nichts (außer Wasser), und im
Norden kann man mit etwas Fantasie Martinique im Dunst erahnen.
Am Abend des 5. Februar segeln wir ein Stück nach Süden –
in die Marigot's Bay. Vermutlich muss jedes Segelboot, das auf St.
Lucia ist, auch in diese Bay fahren. Dicht gedrängt stehen viele
Boote in einer herrlichen Bucht mit Palmen und Sandstrand, im
Hintergrund erheben sich rund herum Berge. Denkt man sich die
Zivilisation weg, zeigt sich hier ein Bild wie in einem Reiseprospekt.
Wir denken uns die Zivilisation nicht weg, sondern – ganz
im Gegenteil –
nutzen sie. Steaks und andere kulinarische Genüsse erfreuen mich
ebenso wie einen Teil der Crew, der schon lange kein Fleisch mehr
gesehen hat. (Lebensmittel waren auf den vorher besuchten Inseln
ziemlich teuer.)
Am nächsten Morgen fahren wir mit dem Schlauchboot an den
Strand, um unter Palmen zu frühstücken. Nutella schmeckt
auch in der Karibik gut, ebenso wie Mango- oder Guavensaft. Schinken,
Käse, etwas Salami und Marmelade runden ein wirklich reichliches
Frühstück ab.
Gegen Mittag verlassen Susi und Klaus das Boot, sie werden noch zwei
Wochen auf einer weiter südlich gelegenen Insel verbringen. Wir
segeln wieder zurück in die Rodney Bay, von wo aus wir am
nächsten Tag Richtung Martinique aufbrechen.
Am Vormittag brechen wir auf. Fahren wir anfangs noch unter Motor
(im Windschatten von St. Lucia), werden wenig später schon die Segel
gehisst. Zwanzig bis dreißig Knoten Wind sorgen für
entsprechende Geschwindigkeit des Bootes, hohe Wellen für
entsprechende Schaukelei und Medikamente gegen Übelkeit für
eine abgeschlossene, vollständige Verdauung.
Bald werde ich Zeuge interessenter Wetterfänomene: Während
in Europa eine meist geschlossene Wolkendecke für Regen sorgt,
sieht man in der Karibik nur kleine Wolken, die nicht einmal besonders
hoch sind. Schon von weiter Ferne kann man erkennen, ob man – je nach
Windrichtung – in den nächsten Minuten nass werden wird oder nicht.
Man kann sich also mental auf einige Sturmböen, etwa zehn Minuten
Starkregen und anschließenden Sonnenschein vorbereiten. Diese
kleinen Fronten sind auch der Grund für eine von mir noch nie
gesehene Anzahl von Regenbögen.
Schon in einiger Kilometer (oder eigentlich Meilen, man möge mir
diese unseemännische Maßeinheit verzeihen) Entfernung vor
Martinique kann man im Wolkenstau der
Berge (jeder Meteorologe hätte hier seine Freude) einen
Vulkan erkennen. Am Nachmittag des 7.
Februar erreichen wir eine Marina im Süden Martiniques. Diese
Insel gehört zu Frankreich, daher also auch zu Schengen. Trotzdem
lässt man uns problemlos einreisen.
Knapp vor Einbruch der Dunkelheit fahren wir noch zwei Buchten weiter
nach Norden. Obwohl das Meer hier mehrere Meter tief ist, kann man
den Grund klar und deutlich erkennen. Mindestens 25 °C warmes Wasser
lädt zum ausgiebigen Badevergnügen in annähernd
unberührter Natur ein. Aus naheliegenden Gründen legen wir
einen Tag Segelpause ein.
Mittlerweile ist der 9. Februar angebrochen. Gemütlich geht's
weiter nach St. Pierre, einem kleinen Hafen im
Norden von Martinique.
Am 10. Februar verlassen wir Martinique in Richtung Dominica. Knapp
bevor wir aufs offene Meer kommen, treffen wir auf einen
Schwarm von wohl um die hundert Delfinen.
Offensichtlich sind wir kein interessanter Spielpartner für sie,
denn wir müssen ihnen immer wieder
nachfahren, um ein paar Fotos schießen
zu können. Selbst Monika und Paul, die sich schwimmend
den Delfinen nähern wollen, schaffen keinen tiefergehenden Kontakt.
Allerdings soll es unter Wasser ziemlich laut sein. Und gelegentlich
springt auch ein Delfin etliche Meter hoch
aus dem Wasser, was unbeschreibliche Eindrücke garantiert.
Doch nicht nur Delfine können fliegen. Hielt ich die Geschichten
von Flugfischen ursprünglich noch für Seemannsgarn, so
werde ich nun eines besseren belehrt. Manchmal fährt das Boot
direkt in einen Schwarm dieser kleinen Fische, die dann fliegend
flüchten. Oftmals legen sie dabei bis zu fünfzig Meter
zurück, rasen in atemberaubendem Tempo knapp über der
Wasseroberfläche über die Wellen dahin. Manchmal – leider
viel zu selten – sehen wir auch große Flugfische mit bis zu
40 cm „Flügelspannweite“.
Nach einigen Stunden des Wellenritts erreichen wir Dominica. Wir
bleiben hier nur über Nacht, da uns in wenigen Tagen auf Guadeloupe
ein neuer Kühlschrank erwartet.
So segeln wir schon am 11. Februar auf die Saints, das sind einige
kleine Inselchen vor Guadeloupe. Sehr zur Freude meines Magens ist
die Überfahrt sehr ruhig. Die Bucht, in der wir – und viele
andere – ankern, ist es nicht ganz so. Ziemlich viel Wind auch auch
leichte Wellen machen das Schlauchbootfahren zu einem wässrigen
Vergnügen.
Das kleine Städtchen in der Bucht ist touristisch aufgeschlossen.
Das ist auch nicht verwunderlich, da neben den vielen Segelbooten auch
zwei große Kreuzfahrtschiffe in der Bucht liegen. Gleichzeitig
mit der Abfahrt der beiden Schiffe werden im Ort auch die Gehsteige
hochgeklappt. Vorher konnten wir – nach einem
langen Landspaziergang –
aber noch richtig gute Cocktails ergattern.
Am nächsten Morgen starten wir dann Richtung Guadeloupe.
Lange dauert die Überfahrt von den Saints nach Guadeloupe.
Einerseits macht uns der sehr ungünstig wehende Wind zu schaffen,
andererseits müssen wir nicht zum Südzipfel der
schmetterlingsförmigen Insel, sondern in die Mitte, nach
Pointe a Pitre. Das – ebenso wie Martinique zu Frankreich
gehörende – Guadeloupe ist eigentlich eine Doppelinsel: Die
westliche Halbinsel ist geologisch sehr jung, vulkanisch aktiv und
großteils von Regenwald bewachsen. Der östliche Teil
hingegen ist flach mit einer eher steppenartigen Vegetation.
Dazwischen befindet sich ein mit Mangroven bewachsener Kanal, der
an seiner seichtesten Stelle weniger als zwei Meter tief ist.
Nachdem wir uns von der anstrengenden Überfahrt ausgiebig erholten,
gehen wir am Nachmittag des 13. Februar in den Stadtkern von Pointe a
Pitre. Von der Marina aus sind das um die zwei Kilometer, die zu einem
guten Teil durch ein eher heruntergekommenes
Stadtviertel führen. Allerdings versichern uns einige
große Schilder (wenn wir diese fremden Wörter richtig
interpretiert haben), dass hier in naher Zukunft ein
Stadterneuerungsprogramm in Angriff genommen werden soll.
Pointe a Pitre ist das Paradebeispiel für den Zusammenhang
zwischen sonntäglicher Ladenöffnung und Menschenanzahl.
Vereinfacht ausgedrückt: keine Öffnung, keine Menschen.
Wir gehen durch annähernd leere Gassen,
treffen ganz selten auf Einheimische oder gar
Touristen und trainieren unsere Vorstellungsgabe
mit imaginären Bildern jener Warenvielfalt, die hinter
heruntergezogenen Rollbalken in den Geschäftslokalen auf den
nächsten Tag wartet. Im einzig offenen Lokal der ganzen Stadt
schlürfen wir ein paar eiskalte Getränke. Der Blick auf
den großen Platz gleich nebenan ist
zwar schön, aber irgendwie fehlen die Menschen. Erst als wir auf
dem Rückweg in die Marina in einem
klitzekleinen Einheimischenlokal eine Rast
machen, bemerken wir, dass wir nicht gänzlich alleine sind in
Pointe a Pitre.
Tags darauf mieten Monika und Dieter ein Leihauto. Wir wollen in den
nächsten Tagen eine Inselrundfahrt machen. Im Moment aber
benötigen wir es für die Suche nach dem Kühlschrank,
der bereits irgendwo auf der Insel sein sollte. Die Suche startet
vormittags beim lokalen Partner von FedEx. Der Kühlschrank sei
bereits im Zoll, aber man müsse Zoll dafür bezahlen.
Bloß ist das Boot, für das der Kühlschrank
gehört, in Gibraltar gemeldet. Und das ist bekanntlich zollfrei.
Dieter und Monika müssen dies zuerst der Zollagentin beibringen,
diese gibt das gänzlich neue Wissen dann an den Zöllner weiter.
Geliefert werde irgendwann am nächsten Tag – zwar direkt auf das
Boot in der Marina, eine genaue Uhrzeit zu nennen, ist man aber nicht
in der Lage. Dafür freut sich die Zollagentin über fast
1000 Schilling für nicht erbrachte Dienstleistungen.
Am späteren Nachmittag fahren wir mit dem Auto ein Stück
auf den älteren Teil der Insel. Ich bin besonders glücklich,
darf ich nun nämlich endlich wieder ein nichtwackelndes,
landgestütztes Fahrzeug steuern. In einer kleinen Ortschaft
kaufen wir uns ein Grillhenderl, das wir auf einer
Steinmole am Strand verzehren. Das
Geschmackserlebnis exotischer Wyrze, einhergehend mit Mangosaft und
die in rötliches Licht eines
Sonnenunterganges getauchten
Palmen am Sandstrand werden mir wohl
lange in Erinnerung bleiben, wenn ich an
kalten Wintertagen in Wien friere.
Nachdem die Sonne unter dem Horizont
verschwunden ist, trinken wir noch ein Gläschen Rotwein
in einem Lokal an der Strandpromenade. Der mit annähernd arktischen
Temperaturen servierte Wein entfaltet schon bald ein recht gutes Aroma.
Und wir sind hier nicht die einzigen Touristen: „Prost, Laundsleit!“
ruft uns ein Oberösterreicher vom Nachbartisch aus zu.
Am nächsten Tag fahren Bine, Paul und ich auf den jüngeren
Teil der Insel. (Monika und Dieter müssen leider auf den
Kühlschrank warten.) Wir benutzen dabei aber teilweise nicht
die Hauptstraßen, sondern kleinere Nebenstraßen. Man
bekommt dabei einfach mehr von Land & Leuten zu sehen. Nach einer
kleinen Wanderung entlang eines Flusses zu einem Wasserfall im
Regenwald fahren wir zum jederzeit ausbrechen könnenden Vulkan.
Entlang kleiner Wege gehen wir durch den Regenwald. Manchmal steigt
uns der Geruch von Schwefel in die Nase; einige warme Quellen
ergießen sich in ein wahrscheinlich durch Eisen rötlich
gefärbtes Bachbett. Die Vielfalt der „Wohnzimmerpflanzen“ ist
schier unermesslich.
Am Abend gehen wir wieder nach Pointe a Pitre. Das vor zwei Tagen
gegessene Henderl ist uns noch gut in Erinnerung; wir wollen diesen
kulinarischen Genuss wiederholen. Als wir nach dem Essen die Sitzbank
auf dem großen Platz (diesmal ist er nicht so menschenleer)
verlassen, werde ich plötzlich von einem Einheimischen am Leiberl
gepackt und mit mir unverständlichen (französischen) Worten
bedacht. Ein zweiter übersetzt: „Give him money or he will
hurt you.“ Schön. Bloß habe ich kein Geld mit, was gleich
wieder ins Französische übersetzt wird.
Ehe ich mich's versehe, liege ich plötzlich auf dem Boden.
Unbewusst habe ich beim Sturz das Geldbörsel in meiner Hose
festgehalten, was dazu führt, dass nun sowohl der potentielle
Dieb als auch ich in meiner Hosentasche an der Geldbörse
ziehen – für Außenstehende wohl ein lustiges Bild.
Paul kommt mir aber gleich zu Hilfe. Nach kleinen Rempeleien ziehen
die beiden plötzlich mit freundlichen Worten („You are friend!“)
ab. Bine hatte in der Zwischenzeit zwei auf einer anderen Bank
sitzende Einheimische um Hilfe gebeten. Diese quittierten dieses
Ansinnen aber nur mit wenig Hilfsbereitschaft: „The police is over there.“
Zwar ist alles noch einmal gut gegangen (wohl auch dank der
Unfähigkeit der beiden Diebe), doch haben wir für heute
genug; wir gehen rasch zu einem Taxi und fahren zurück in
die Marina.
Mittlerweile ist der 16. Februar angebrochen. Nachdem wir das
Leihauto zurück gegeben und viele Nahrungsmittel gekauft hatten,
fahren wir ein paar Meilen bis knapp vor Beginn des Kanals, der
zwischen den beiden Halbinseln verläuft. Dieser ist nicht
besonders breit und vor allem nicht besonders tief. Als der Tiefenmesser
nur mehr 1,60 m anzeigt, bleibt das Boot auch kurz im Schlamm stecken.
Doch ein kräftiger Motor befreit uns rasch wieder aus dieser
misslichen Lage.
Wir verbringen die Nacht vor der Autobahnbrücke, die
täglich um 4:30 Uhr hochgezogen wird, um Segelschiffe passieren
zu lassen. Noch bei ziemlicher Dunkelheit fahren wir in den Kanal;
links und rechts können wir Mangroven in der Finsternis erahnen.
Wir haben ständig den Tiefenmesser im Auge, der aber beruhigende
Werte liefert: Meist ist das Wasser tiefer als drei Meter; wir
vermuten, dass man den Kanal in den letzten Jahren ausgebaggert hat.
In der ersten Morgendämmerung vernehmen wir den Lärm eines
zum Start rollenden Flugzeuges. Alles starrt gebannt in eine Richtung,
bis wir zwischen den Mangroven ein Flugzeug sehen – ganz knapp vor dem
Kanal. Wir befürchten schon, richtiggehend umgeweht zu werden,
wenn das Flugzeug startet. Davor bleiben wir verschont – nicht aber vor
dem großen Lärm.
Wir ankern in sicherer Entfernung zum Flughafen in einer Art
„Mangrovengarage“, um noch ein wenig
weiter zu schlafen.
Im Laufe des Vormittags werden wir plötzlich von einer Unmenge
von winzig kleinen Mücken regelrecht angegriffen, was uns zum
sofortigen Aufbruch zu einem Riff nördlich des Kanals zwingt.
Monika und Dieter schnorcheln, laut ihren Berichten ist aber nicht
besonders viel zu sehen.
Wir segeln also bald weiter zu einer kleinen Bucht im Nordosten
von Guadeloupe. Der obligatorische Landgang führt uns auch zum
örtlichen Friedhof. Oftmals sind die Gräber hier keine
Gräber, sondern verflieste Hütten, die manchmal sogar
schöner sind als die Häuser, die die Menschen zu ihren
Lebzeiten bewohnen. Manchmal wurden die Gräber einfach nur
mit einer Blechwanne eingefriedet, manchmal fehlt auch das; man
muss also aufpassen, dass man nicht einfach über ein Grab geht.
Am Rückweg kaufen wir noch Fisch für das Abendessen.
Dieter erzählte, dass sie bei der Atlantiküberquerung
immer Fische gefangen hätten; zwischen den Inseln ist das
dann aber nicht mehr gelungen. Oftmals hing die Leine mit dem
Köder sinnlos ins Wasser, nicht einmal der sprichwörtliche
Schuh biss an.
Am 18. Februar ist die letzte Etappe meiner Reise angebrochen – wir
segeln nach Antigua. Dank wirklich starkem Wind ist die ziemlich
große Distanz in wenigen Stunden überwunden, wir kommen
so gegen 16:00 Uhr im English Harbour an.
Wir stellen bald fest, dass der Hafen in Wirklichkeit ein
Museumstädtchen ist, für
dessen Besuch Unmengen von Touristen, die von Kreuzfahrtschiffen
kommen, Eintritt zu bezahlen haben.
Nachdem ich dem Zöllner mein Flugticket gezeigt hatte (sonst
hätte er mich nicht von der Crewliste gestrichen), fahre ich
schon ziemlich lange vor dem Abflug mit dem Taxi zum Flughafen von
Antigua. Es war mir leider nicht möglich, den Flug zu
bestätigen, und ich wollte nichts riskieren. Außerdem
wollte ich mich nach einem früheren Flug von London nach
Wien erkundigen. (Leider habe ich schon den frühesten Flug.)
Ich bereite mich nun also schon geistig auf neun Stunden Warten
in London-Gatwick vor.
Doch auch diese Zeit geht rasch vorüber. Gute zwei Kilogramm
Sunday Times helfen dabei ungemein. Als ich nach mehr als
dreißig Stunden ohne nennenswerten Schlaf in einem Flugzeug
der Lauda Air Schweinsrücken mit Speckfisolen esse und im
Kurier ein Bild vom wohlgefüllten Heldenplatz sehe, weiß
ich, dass ich sehr gerne wieder heim komme.
Ob ich wieder eine solche Reise machen würde?
Jederzeit. Aber nicht morgen.